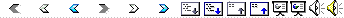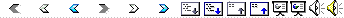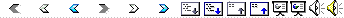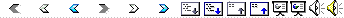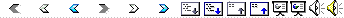|
1
|
- Prinzipien, Ansätze, Beispiele
- R. Albertin, Heilpädagoge
- Leiter Zentrum Pestalozzihaus
- Zürich, den 10. Nov. 05
|
|
2
|
- Die Verhaltenstheorie
- erklärt die psychodynamische Struktur eines Individuums
- erklärt organisch-genetisch bedingte Differenzen
- erklärt die Dynamik und Funktion von Beziehungen
- erklärt die funktionalen Zusammenhänge zwischen Kontext und Individuum
- erklärt die funktionalen Beziehungen zwischen einem Verhalten und
seinen vorausgehenden, begleitenden und nachfolgenden Reizbedingungen
|
|
3
|
- Organisch-genetische Differenzen sind bestimmend.
- versus
- Gelernte Differenzen sind bestimmend.
|
|
4
|
- Persönlichkeitsstruktur, Emotionen und Antriebe sind bestimmend.
- versus
- Das Lerninventar ist bestimmend.
|
|
5
|
- Beziehungsdynamik und Kommunikation sind bestimmend.
- versus
- Lernprozesse sind bestimmend.
|
|
6
|
- Kontextuelle Faktoren sind bestimmend.
- versus
- Das aktuelle „Lernsetting“ mit seinen Signal- und Steuerreizen ist
bestimmend.
|
|
7
|
- Das Modell basiert auf Lernen und konzentriert sich auf das Verhalten.
- Das Lernmodell behandelt abweichendes Verhalten direkt.
- Das Lernmodell geht vom dem Standpunkt aus, dass allem Verhalten
dieselben psychologischen Prinzipien zugrunde liegen.
- Das Lernmodell bedient sich derselben Methoden der Erforschung von
Humanverhalten wie alle anderen Wissenschaften (Empirie).
|
|
8
|
- Das Lernmodell fordert von Beobachtern keine besonderen theoriebezogenen
Fertigkeiten, doch setzt es die
Fähigkeit voraus, entsprechende Messungen vorzunehmen.
- Lernorientierte Positionen anerkennen die wichtige Rolle, die vergangene
Vorgänge bei der Formung erlernter Verhalten gespielt haben. Trotzdem
sind Verhaltensmodifikations-programme
immer mit gegenwärtigen Verhaltensstörungen befasst.
|
|
9
|
|
|
10
|
- Klassisches Konditionieren
- Operantes Konditionieren
- Modell-Lernen
|
|
11
|
- Futter führt zur Speichelabsonderung beim Hund (Reflex)
- Ton führt nicht zur Speichelabsonderung
- nach öfterer zeitlicher Paarung von Futter und Ton löst der Ton eine
Speichelabsonderung aus (bedingter Reflex).
|
|
12
|
- Wird die richtige Tafel im Signalkasten gezeigt
- und durch ein Picken an der Scheibe getroffen
- hebt sich der Futtertrog kurz
- die Taube kann sich ihre Belohnung holen.
- Bei der falschen Tafel erhält sie keine Belohnung.
|
|
13
|
- Unter Modelllernen wird die Aneignung, Aktualisierung oder Veränderung
von Verhaltensweisen durch die Beobachtung einer anderen Person
verstanden.
- Das Paradigma des Modelllernens ist von Bandura in den 60er-Jahren
ausgearbeitet worden. Er hat damit die Grundlagen für die kognitive
Wende der Verhaltensmodifikation gelegt.
|
|
14
|
- Psychosoziale Vorgänge die als Verhaltensstörungen oder auffälliges
Verhalten diagnostiziert werden
- (Unterschreiten / Überschreiten üblicher Verhaltensmodi)
- lassen sich als Lernprozesse beschreiben.
|
|
15
|
- Watson, Pawlow, Thorndike bis 1930: Zwischen Reiz und Reaktion geschieht
nichts «Black box».
- Skinner, Dollard, ... bis 1960: Die «Black box» ist relevant, aber kaum
zugänglich.
- Lewin, Bandura, ... bis 1980: Das Verhalten wird durch Person und Umwelt
bestimmt [V=P*U], bzw. besteht ein reziproker Determinismus.
|
|
16
|
- systematische Verhaltensbeeinflussung
- durch geplantes, kontrolliertes Vorgehen
- orientiert an lerntheoretischen Paradigmen
|
|
17
|
|
|
18
|
- durch die dem Verhalten vorausgehenden Ereignisse
- durch mentale Prozesse
- (Kognitionen, motivationale Konstellationen, Gefühle)
- durch die nachfolgenden Ereignisse (Verhaltenskonsequenzen)
|
|
19
|
- Problemdefinition
- Legitimationsprüfung
- Ist-Analyse (Datenerhebung)
- Soll-Analyse (Festlegung der Zielverhaltensweise)
- Erarbeitung eines Modifikationsplanes
- Durchführung der Massnahmen
- Evaluation der Zielerreichung (Kontrolle der Effektivität)
- Sicherung des Zielverhaltens (Generalisierung)
|
|
20
|
- An erster Stelle steht eine möglichst klare Problem-definition auf der
Grund-lage von Informationen über beobachtete Verhal-tensschwierigkeiten
und problemhafte Situationen.
|
|
21
|
- eindeutig, abgrenzbar
- sichtbar
- personunabhängig
- zählbar, wiederholbar, überprüfbar
|
|
22
|
- Gemurmelte oder gesprochene Kommentare ohne vorbestimmten Empfänger
(gleicher Inhalt = 1 Kommentar)
- Dienstag 9-10 Uhr Sprache
- Mittwoch 9-10 Uhr Realien
- Donnerstag 14-15 Uhr Zeichnen
|
|
23
|
- wird meine Einschätzung des fokussierten Verhaltens geteilt?
- ist es sinnvoll, das fokussierte Verhalten mit den Mitteln der
Verhaltensmodifikation anzugehen?
- bin ich berechtigt und geeignet, das fokussierte Verhalten anzugehen?
|
|
24
|
- Gemütszustände (Trauer, Freude, Wut ...) sind nicht geeignet.
- Privates, Persönliches (z.B. Bettnässen) ist nicht zulässig.
- Bindung an individuelle Sichtweisen (z.B. keine Hosen tragen) ist nicht
zulässig.
- Loyalitätsbezeugungen (z.B. hier besser sein als dort) sind nicht
zulässig.
|
|
25
|
- Zusammenhänge in den Verhaltensweisen aufdecken zwischen:
- vorhergehenden Stimuli,
- den begleitenden (Kognitionen)
- und nachfolgenden Ereignissen (Konsequenzen)
- begründete Hinweise für die Erstellung eines Modifikationspla-nes
liefern
- einen Beurteilungsmassstab für die Zielverhaltensweise finden helfen
- Daten liefern, an denen im Verlauf der Modifikation gemessen werden
kann, ob die eingesetzten
Massnahmen wirksam sind oder nicht und die Modifikation als gelungen
bezeichnet werden kann.
|
|
26
|
|
|
27
|
|
|
28
|
- In der Soll-Analyse wird das Modifikationsziel operational bestimmt.
- Festlegungen sollten auf der Basis der Grundratendaten (IST-Analyse)
gemeinsam mit den Betroffenen erfolgen.
|
|
29
|
- 3 oder mehr gerichtete Interventionen pro Lektion
- 1 oder keine ungerichtete Intervention pro Lektion
|
|
30
|
- Operationalisierung des Problem- und des Zielverhaltens
- Welche sind die relevanten Situationen?
- Welche Verstärker sollen eingesetzt werden?
- Können die Verstärker wirklich unmittelbar nach dem Verhalten gesetzt
werden oder gibt es dabei Probleme?
|
|
31
|
- belohne sofort
- belohne häufig mit kleinen Beiträgen
- Leistung belohnen, nicht Gehorsam
- belohne fair, klar, ehrlich, positiv
- belohne systematisch
|
|
32
|
- Vertragspartner
- Vertragsbestimmungen (Geschäft)
- Vertragsdauer
|
|
33
|
- Vertragspartner: R. Albertin und Ron
- Vertragsdauer: 22. Nov. – 3. Dez.
- Bestimmungen:
- Roni
- streckt am Dienstag (Sp), Mittwoch (Ra) und Donnerstag (Z) jeweils
mindestens 3x auf und gibt einen Beitrag.
- macht in obigen Lektionen nicht mehr als 1 ungerichtete Intervention
- Herr Albertin
- gibt Roni nach jeder Stunde ein Fussballbild zur Auswahl
- macht am Freitag im Turnen jeweils Fussball
|
|
34
|
- Vertragsvereinbarungen:
- Die Anweisungen aller Lehrer sofort befolgen
- Mehr positive Äusserungen, Respekt zu Hause
- Den andern helfen; aufstrecken und Zeichen von Lehrer abwarten
- keine Drohungen mehr gegenüber Lehrkräften
|
|
35
|
- In der Schule praktizierte Verhaltensmodifikation ist häufig sehr
erfolgreich, wenn es gelingt, Eltern an der Intervention zu beteiligen.
- Vor allem in Bezug auf Schüler, für die in der Schule wählbare
Verstärker nicht effektiv sind, oder für die das Elternhaus die
Hauptquelle für Verstärkung ist
|
|
36
|
|
|
37
|
- Der Schüler Adrian verpflichtet sich, vom 16. August bis zum 8. Oktober:
- zu Hause 07.15 Uhr angezogen am Tisch
- 07.40 die Wohnung verlassen
- Schule Buchabschnitt auswendig erzählen Am Di unaufgefordert in
Therapie
- Turn- und Badzeug dabei
- Hort unaufgefordert Hausaufgaben beginnen
- Initiative für ein Spiel ergreifen
|
|
38
|
|
|
39
|
- 50 Punkte: Begleitung des Vaters nach Italien zu den antiken Schätzen
- 20 Punkte: ein Modellbau-Flugzeug
- 20 Punkte: zusammen einen Coupe essen
- 20 Punkte: ein Nachmittag mit der ganzen Familie im Hallenbad
|
|
40
|
|
|
41
|
|
|
42
|
- Modifikationsziele erreicht?
- Interventionen angemessen?
- Verstärker angemessen?
- situative Einflüsse?
|
|
43
|
- Stärkung oder Ausformung angemessenen Verhaltens:
- Transfergebot: Das aufgebaute Verhalten in vielen relevanten
Situationsfeldern verwirklichen
- Stabilitätsgebot: Das aufgebaute Verhalten dauerhaft aufrecht zu
erhalten
- Einbindung des gelernten Verhaltens in einen Stimulus- und
Verstärkungskontext
|
|
44
|
- Modell-Lernen
- Selbstinstruktion
- Entspannungsverfahren
|
|
45
|
- Modelllerntechniken haben sich insbesondere bei regredierten,
ängstlichen und gehemmten Kindern, bei Vorliegen mutistischen Verhaltens
sowie bei sozia-len Verhaltensstörungen in Verbindung mit Rollenspiel bewährt.
|
|
46
|
- Die Befähigung des Lernenden zu Selbststeuerung und Selbstregulation ist
in der Verhaltenstheorie zentral. Eine besondere Interventionsform ist
das Selbstinstruktionslernen. Selbstinstruktionstrainings machen sich die Handlungsregulation
durch Sprache zunutze.
|
|
47
|
- Entspannungsverfahren schaffen die notwen-digen Voraussetzun-gen (z.B.
AT).
|
|
48
|
- In den Praxisfeldern der pädagogischen Verhaltensmodifikation sind
überdies gruppenbezogene Ansätze mit Erfolg erprobt worden.
|
|
49
|
- Aufgaben vollständig und vor 08.00 Uhr auf dem Lehrertisch
- Keine Intervention des Lehrers während der Lektion notwendig
- Nach der Pause ruhig am Platz arbeitend
- Turn- und Badzeug vollständig
|
|
50
|
- Was könnte ein +1 geben?
- tadelloses Benehmen (Grüssen, Warten, Essen, Haltung, ...)
- kooperatives Verhalten
- eine freiwillige Zusatzarbeit
- Pünktlichkeit
- selbständige Sorge um Kleidung und Hygiene
- sehr gute Schulleistungen
- Was könnte ein -1 geben?
- ungenügender Gehorsam
- Schulausschluss in irgend einer Form
- Schimpfwörter
- freche Reaktionen
- Streitereien
- ungenügendes Erledingen von Hausaufgaben (Menge, Qualität)
- ungenügendes Erledigen von Aemtlis (Menge, Qualität)
- zu spät kommen
|
|
51
|
|
|
52
|
|
|
53
|
- Randprobleme
- kein spontanes Handeln
- kaum Einsichten
- keine Lösung innerseelischer Konflikte
- mechanistisch und unpersönlich
- Verwöhnung durch Verstärkung
- Manipulation und Fremdsteuerung
|
|
54
|
- abgegrenzte Dauer der Massnahme
- Situationsbezogenheit
- keine Ausschluss von Laien
- Wirksamkeit kann kontrolliert werden
- Transparenz des Verfahrens
- konkrete und beobachtbare Phänomene
- Erfolg wissenschaftlich nachgewiesen (K. Grawe, Bern)
- genaues Beobachten notwendig
- Einbezug von der Betroffenen
|
|
55
|
|
|
56
|
|
|
57
|
- Gruppenbildung (4-5) Personen
- Auswahl eines Fallbeispiels (Kind mit schwierigem Verhalten) aus der
Praxis
- Entwicklung eines Modifikationsplanes, inkl. Kontingenzvertrag
- Zu definieren sind insbesondere:
- störendes Verhalten (Ist-Situation)
- Zielverhalten (Soll-Situation)
- Verstärker
- Durchführung
- Beteiligte
- Fragen und Schwierigkeiten notieren
- Abgabe der entwickelten Unterlage
|
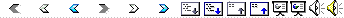
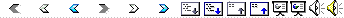
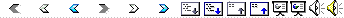
 Notizen
Notizen